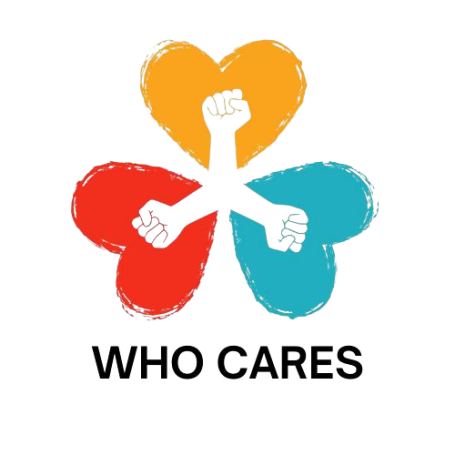Ökonomisierung der Sozialen Arbeit
Wie es zur Ökonomisierung des
Nicht-Ökonomischen in den letzten 30 Jahren kam
Eva Weides
Einleitung
Ich arbeite seit 15 Jahren als Diplom-Pädagogin in unterschiedlichen Feldern der Sozialen
Arbeit. In dieser Zeit verspürte ich in meinem Arbeitsalltag einen zunehmenden
ökonomischen Druck, beispielsweise in der Umsetzung von Angeboten für Klient*innen.
Mein Berufsethos verfolgt den Anspruch, Menschen an der Gesellschaft teilhaben zu lassen.
Allerdings ist mein pädagogischer Arbeitsalltag vom Verwalten von Mangel und Ringen um
Handlungsfähigkeit geprägt.
Aus der Motivation heraus, Strukturen in dem Berufsfeld der Sozialen Arbeit zu ändern, habe
ich das Studium an der Hochschule für Gesellschaftsgestaltung begonnen. Durch das Seminar
der Kultur- und Ideengeschichte habe ich Wissen über historische Wirtschaftsentwicklungen
gesammelt, die zur sozial-ökologischen Krise geführt haben. Um Änderungen im aktuellen
System mit entwickeln zu können, muss ich die Ursprünge der derzeit vorherrschenden
gesellschaftlichen Lage mit ihren Missständen zunächst analysieren und verstehen lernen.
In dieser Hausarbeit möchte ich systematisch untersuchen, inwieweit meine persönlichen
Erfahrungen symptomatisch für einen Paradigmenwechsel im Berufsfeld der Sozialen Arbeit
stehen. Deshalb untersuche ich im Rahmen dieser Hausarbeit einige ausgewählte
(sozial)politische Entwicklungen, die dazu geführt haben, dass das Konzept „des Markts“ in
das Berufsfeld der Sozialen Arbeit eingedrungen ist und eine Ökonomisierung durchlaufen
hat.
Begriffsbestimmungen
An dieser Stelle werden grundlegende Begriffe im Rahmen dieser Arbeit definiert und
beschrieben. Zu ihnen gehören zum einen der Begriff der Sozialen Arbeit mit den
Beschreibungen des Doppelmandats und des Tripelmandats. Zum anderen
erfolgt die Definition des Begriffs der Ökonomisierung. Anschließend erfolgt eine kurze
Beschreibung zur kulturhistorischen Betrachtung des Konzepts „des Marktes“ . Sie
aufgeführten Begriffe bilden die Grundlage zum weiteren Verständnis dieser Arbeit.
Soziale Arbeit
Das Berufsfeld der Sozialen Arbeit ist erst mit der zunehmenden Industrialisierung im 19.
Jahrhundert entstanden und als eine Begleiterscheinung des Kapitalismus anzusehen. Sie
kann daher als „Kind der Moderne“ betrachtet werden (vgl. Hering and Münchmeier, 2007),
“[um] auf die vom Kapitalismus verursachte Beschädigung der Individuen
einzuwirken“ (Böhnisch et al., 2005, p. 103) und so soziale Mängel aufzufangen. Soziale
Arbeit beschäftigt sich mit der sogenannten sozialen Frage. Ging es zunächst darum, mit dem
Begriff der sozialen Frage die Auseinandersetzung der sozialen Missstände, die durch die
industrielle Revolution entstanden sind, zu beschreiben, manifestierte sich im Ausdruck der
sozialen Frage im historischen Verlauf des Kapitalismus die Vergrößerung der Probleme der
Menschen in der Gesellschaft. Soziale Arbeit trägt mit ihrer Profession zur Entschärfung der
sozialen Frage bei (vgl. Seithe, 2012, p. 39 f.) und „impliziere damit immer ein System
stützendes wie auch ein systemkritisches Moment“ (ebd., p. 40).
Nach dem Deutschen Berufsverband für Soziale Arbeit „[…] fördert [Soziale Arbeit] als praxisorientierte [.] Profession und wissenschaftliche Disziplin gesellschaftliche Veränderungen, soziale Entwicklungen und den sozialen Zusammenhalt sowie
die Stärkung der Autonomie und Selbstbestimmung [.] von Menschen. Die Prinzipien sozialer
Gerechtigkeit, die Menschenrechte, die gemeinsame Verantwortung und die Achtung der Vielfalt [.] bilden die Grundlage der Sozialen Arbeit. Dabei stützt sie sich auf Theorien der Sozialen Arbeit [.], der Human- und Sozialwissenschaften und auf indigenes Wissen[.]. Soziale Arbeit befähigt und ermutigt Menschen so, dass sie die Herausforderungen des Lebens bewältigen und das Wohlergehen verbessern, dabei bindet sie Strukturen ein. […].“ (Deutscher Berufsverband für Soziale Arbeit e.V.).
Aus der Definition des Deutschen Berufsverbandes für Soziale Arbeit wird bereits ersichtlich,
dass das Berufsfeld der Sozialen Arbeit ein breites Aufgabenspektrum impliziert. Zum
weiteren Verständnis wird im Folgenden auf die Spezifika der Profession der Sozialen Arbeit
eingegangen. Zu ihnen gehört als eines der Hauptmerkmale die sogenannte Allzuständigkeit.
Im Gegensatz zu Physiker*innen oder Bäcker*innen haben Sozialarbeitende keine
ausdrücklichen und in sich abgeschlossenen Zuständigkeiten. Seithe (vgl. 2012, p. 49)
beschreibt es so, dass es für Sozialarbeitende keine Option sei, sich nicht für auftretende
Probleme zuständig zu erklären. Nach Thiersch verfügt Soziale Arbeit über „das Grundmuster
von Ganzheitlichkeit, Offenheit und Allzuständigkeit“ (Thiersch, H., 1993, p. 11). Dies führt
dazu, dass es in der Sozialen Arbeit kein eigenständiges Arbeitsfeld gibt und es immer
Professionen gibt, die sich als Spezialist*in im entsprechenden Lebensabschnitt besser
auskennen (vgl. Seithe, 2012, p. 49). Somit sind
„Sozialarbeitende […] SpezialistInnen für den menschlichen Alltag in seiner Ganzheit, mit seinen
Zusammenhängen und Vielschichtigkeiten, sie sind Professionelle, deren Professionalität sich eben
genau darin zeigt, dass sie sich nicht auf Zuständigkeiten zurückziehen und auf ihr Spezialgebiet
beschränken können“ (ebd.).
Ein weiterer Gesichtspunkt in der Profession der Sozialen Arbeit besteht in darin, dass
professionelles pädagogisches Handeln im Alltag der Klient*innen selbst stattfindet. Es hat
mit dem Alltag von Menschen zu tun und arbeitet daher auch mit diesem. Pädagogisches
Handeln beginnt oft mit alltäglichen Situationen. Letztlich ist ein weiteres wesentliches
Prinzip der Sozialen Arbeit die Alltagsorientierung. Als letzter Aspekt wird hier die
Unterstützung der Stärkung der sozialen Netzwerke der Klient*innen angeführt. Mit der
zwischenmenschlichen Solidarität professioneller Hilfe steht der Aufbau und Wiederaufbau
menschlichen Verbundenheit im Vordergrund professionellen pädagogischen Handelns. (vgl.
ebd., p. 49 ff.).
Zusammenfassend kann gesagt werden, dass Soziale Arbeit „[…] eine indirekt vorbeugende,
unterstützende, eine direkt helfende und auch eine politische Dimension [hat]“ (Schilling and
Klus, 2018, p. 227). Die Verbindung zwischen Sozialer Arbeit und Sozialpolitik wird hier
bereits deutlich.
Doppelmandat
Die Entstehung und Eingebundenheit Sozialer Arbeit in den Sozialstaat und das damit
verbundene gesellschaftliche und ökonomische System führt zu dem sogenannten doppelten
Mandat der Sozialen Arbeit. Böhnisch und Lösch (1973) haben diesen Begriff geprägt. Er
verdeutlicht zwei Aspekte des pädagogischen Arbeitens. Einerseits ist Soziale Arbeit
grundsätzlich der gesellschaftlichen Interessenslage verpflichtet (vgl. Seithe, 2012, p. 68).
Andererseits besteht ihr Auftrag darin, benachteiligten Menschen bzw. Gruppen darin zu
unterstützen, ihren Alltag so selbstständig wie möglich zu bewältigen und sie zur
gesellschaftlichen Teilhabe und Mitbestimmung zu befähigen. Hierzu zählt auch die
Vermittlung der Kompetenz, sich gegen die erfahrenen Benachteiligungen und
Ungerechtigkeiten einzusetzen (vgl. ebd., p. 68 f.). Zugespitzt kann das doppelte Mandat der
Sozialen Arbeit so verstanden werden, dass konkrete Unterstützungs(leistungen) (vgl.
Schilling and Klus, 2018, p. 229) dem Ausüben von „(hoheits)staatlicher Kontrollfunktion
durch die Berufsgruppe“ (ebd.) gegenüberstehen.
Diese zwei Aufträge führen in der praktischen Arbeit zu einem Spannungsfeld zwischen
Kontrolle und Unterstützung und spiegeln sich im Ausdruck des doppelten Mandats wider
(vgl. Fehmel, 2019, p. 205). Hieraus entsteht ein Dilemma des Berufsfeldes Soziale Arbeit.
Professionelles pädagogisches Handeln bewegt sich zwischen einem institutionell-organisatorischen geprägten Handlungsrahmen und den Notwendigkeiten, die sich aus der Lebenswelt der Menschen begründen (vgl. Spiegel, 2008, p. 37).
Seithe schließt aus den zwei widersprüchlichen Aufträgen innerhalb des doppelten Mandats,
dass „Soziale Arbeit [.] keine Kraft [ist], die eine Gesellschaftsveränderung selbst herbeiführen kann, denn sie ist immer durch ihr doppeltes Mandat an die Auftrag gebenden herrschenden politischen Kräfte gebunden“ (2012, p. 69).
Für das Berufsfeld Soziale Arbeit bleibt zusammenfassend zu sagen, dass es immer in einem
„historischen und sozialpolitischen Kontext“ (Spiegel, 2008, p. 36) stattfindet und „[…]
gesellschafts- und berufspolitischen Macht- und Aushandlungsprozessen[unterliegt]“ (ebd.).
Tripelmandat
Mit der Professionalisierung des Berufsfeldes Soziale Arbeit hat sich die Perspektive des
Mandats der Sozialen Arbeit ebenfalls weiterentwickelt. Silvia Staub-Bernasconi prägte den
Begriff des Tripelmandats. Dieses Mandat wurde um die Aspekte der
Wissenschaftsorientierung, berufsethische Prinzipien sowie Menschenrechtsprofession
erweitert. Mit der Wissenschaftsorientierung bezieht sich Soziale Arbeit auf wissenschaftlich
begründete Theorien und Methoden (vgl. Schilling and Klus, 2018, p. 229 f.). Berufsethische
Prinzipien drücken sich in einem Berufskodex aus. Nach Brumlik (vgl. 2004, p. 229 f.) soll er in
berufsethischen Entscheidungsprozessen die „advokatische Ethik“ widerspiegeln. Soziale
Arbeit ist als demnach als Arbeitsfeld zu verstehen, indem Angestellte in der Sozialen Arbeit
im Auftrag ihrer Klient*innen deren Interessen vertreten. Das anwaltschaftliche bzw.
beistandschaftliche Wahrnehmen für das Klientel ist handlungsleitend. Der Berufskodex
dient der Regelung zentraler Fragen der professionellen pädagogischen Arbeit. Er gibt
Beistand und Rückhalt für Situationen im Arbeitsalltag, in denen institutioneller oder
staatlicher Druck bzw. Einflussnahme oder Haltungen aus dem gesellschaftlichen Zeitgeist
schädlichen Einfluss auf die pädagogische Arbeit zu nehmen drohen (vgl. Brumlik, 2004, p.
161, vgl. Schilling and Klus, 2018, p. 230).
Der Deutsche Berufsverband für Soziale Arbeit e.V. formuliert in seinen Grundsätzen die
Zusammenhänge von Sozialer Arbeit, (Sozial)Politik, ökonomischen Bedingungen und
gesellschaftlichen (Macht)Verhältnissen (vgl. ebd.). Nach Seithe (vgl. 2012, p. 69) sieht sich
Soziale Arbeit als eine Profession, die einerseits innerhalb der vorgegebenen
gesellschaftlichen Rahmenbedingungen Menschen darin unterstützen kann, die
notwendigen Teilhabechancen wahrzunehmen. Andererseits setzt sie auch Impulse
gegenüber der herrschenden Politik. Maurer (vgl. 2006, p. 195 f.) fasst Soziale Arbeit treffend
zusammen, in dem sie formuliert, dass Soziale Arbeit potentiell eine politische,
gesellschaftliche Bewegung ist, die gleichzeitig auch immer auch einer hohen
Anpassungsfähigkeit bedarf. Dieser Aspekt drückt ebenfalls die Brückenfunktion Sozialer
Arbeit aus. Sie bewegt sich auf der einen Seite in den Feldern der Institutionalisierung,
staatlicher Finanzierung, rechtlicher Reglementierung. Auf der anderen Seite erhält sie ihre
Existenzberechtigung durch die Bearbeitung der Probleme der unterschiedlichen
Lebenswelten, in dem sie sich auch sprachlich in der entsprechenden Lebenswelt bewegt (vgl.
Galuske, 2002, p. 136)
Ökonomisierung
Seit 30 Jahren beschreiben einige markante Begriffe die gesellschaftliche Situation, in der wir
uns befinden. Zu ihnen zählen „Liberalisierung“, „Deregulierung“, „Managerialisierung“,
„New Public Management“, „Privatisierung“, „Entrepreneurisierung“, „Kommodifizierung“,
„Kommerzialisierung“, „Finanzialisierung“ und „Vermarktlichung“, „Verbetrieblichung“,
„Verkaufmännischung“ (vgl. Schimank and Volkmann, 2017, p. 109; vgl. Tabatt-Hirschfeldt,
Andrea, 2018, p. 89). Der Begriff der „Ökonomisierung“ drückt für Schimank und Volkmann
alle darin enthaltenen Aspekte am eindrücklichsten aus (vgl. Schimank and Volkmann, 2017,
p. 9). Ökonomisierung wird als „[…] Bedeutungszuwachs ökonomischer Kosten- und Gewinn-
Gesichtspunkte für gesellschaftliches Handeln benutzt“ (ebd., p. 10).
Bei der Auseinandersetzung mit der Ökonomisierung des Nicht-Ökonomischen geht es um
die Fälle, in denen sich die Widersprüche aufgrund der Kosten- und Gewinngesichtspunkte
den nicht-wirtschaftlichen Wertmaßstäben offensichtlich gegenüberstehen (vgl. ebd., p. 13).
Volkmann und Schimank setzen bei der Auseinandersetzung der Ökonomisierung des Nicht-
Ökonomischen nicht den Fokus auf die Perspektive, bei der Leistungsempfänger direkt von
Leistungsreduktionen betroffen sind. Ihnen geht es vielmehr um die Betrachtungsweise von
betroffenen Organisationen und deren Mitarbeiter*innen und den damit
zusammenhängenden Wirkungsketten der Ökonomisierung (vgl. ebd., p. 14).
Zusammenfassend und abschließend werden nochmals zwei Beschreibungen zur
Ökonomisierung angeführt. Höhne (2015, p. 20) definiert Ökonomisierung als
"[…] eine nachhaltige Strukturveränderung sozialer Felder […], durch die – vermittelt durch Staat und politisch legitimierte Akteure - ökonomische Elemente, Prinzipien, Regeln, Wissen und Diskurse systematisch auf außerökonomische Felder übertragen, in diese übersetzt oder von diesen spezifisch adapiert und dynamisch an die feldeigene Logik angepasst oder auch widerständig transformiert werden."
Während Höhnes Definition in ihrer Ausführlichkeit die Auswirkungen und insbesondere
Durchdringung von Ökonomisierung in zahlreichen Ebenen und außerökonomischen Feldern
widerspiegelt, bringt es Galuske folgendermaßen auf den Punkt: Ökonomisierung bedeutet
„die Verschiebung des Kräfte- und Machtverhältnisses von Markt, Staat und privaten
Haushalten zugunsten des Marktes“ (2002, p. 144). Wie sich diese Verschiebung des Kraft –
und Machtverhältnisses in der Sozialen Arbeit widerspiegelt, wird in Kapitel 3 ausgeführt.
Kulturhistorische Betrachtung des Konzepts „des Markts“
Um das Eindringen von Marktstrukturen in und deren Konsequenzen für das Berufsfeld der
Sozialen Arbeit kritisch betrachten, hinterfragen und einordnen zu können, wird an dieser
Stelle kurz die kulturhistorische Entwicklung des Konzepts „des Markts“ skizziert. Eine
tiefergehende Analyse und Betrachtung im Rahmen der Kultur- und Ideengeschichte der
Ökonomie zum Konzept des „Marktes“ kann im Rahmen dieser Arbeit nicht geleistet werden.
Das Konzept „des Marktes“ ist heute allseits bekannt. In der Geschichte der Ökonomie
entstand es allerdings erst Anfang des 20. Jahrhunderts. Adam Smith stellte „den Markt“ als
„[…] den konkreten Ort von Tauschvorgängen [dar], auch historisch gesehen, und ebenso ist
der Markt auch der allgemeine Ort für Käufe und Verkäufe“ (Ötsch et al., 2018, p. 70).
„Markt“ wird hier weder bereits als Synonym für Wirtschaft verwendet noch als politischer
Handlungsleitfaden (vgl. ebd.). Dies bleibt auch noch im 19. Jahrhundert so. Das Konzept
„des Marktes“ ist ein Konstrukt, das also vor fast 100 Jahren von Ökonomen eingeführt
wurde (vgl. Ötsch, 2019, p. 12). Anhänger verschiedenster Richtungen agierten ab den
1920er Jahren in zahlreichen Netzwerken, um das Konstrukt „des Marktes“ in die
Gesellschaftsordnung zu etablieren. Bedeutende Namen sind Ludwig von Mises und
Friedrich August von Hayek (Österreichische Schule), Wilhelm Röpke und Walter Eucken
(Ordoliberalismus), Henry Calvert Simons (frühere Schule von Chicago) und Lionel Robbins
weitere britische Ökonomen (vgl. ebd., p. 12). In ihren unterschiedlichen Ansätzen vereint sie
alle die Idee „des Marktes“ (vgl. ebd., p. 13). Bis zum zweiten Weltkrieg hatten sie damals
noch keine große Verbreitung. Dies änderte sich danach zunehmend und (vgl. ebd., p. 17) in
den 1970er-Jahren hatte es das Netzwerk einerseits in die Politik, andererseits auch in die
ökonomische Theorie geschafft (vgl. ebd., p. 17).
Die 1980er-Jahre brachten es mit sich, dass sich „der Markt“ weltweit als dominantes Dogma
etablierte und „[als] das theoretische Grundgerüst einer ökonomisierten Gesellschaft, die
seit den 1990er-Jahren entstanden ist“ (vgl. ebd.). „“Der Markt“ ist eine aber eine Fiktion, die
als soziale Überzeugung zu einer kulturellen Wirklichkeit geworden ist“ (ebd., p. 9). Sie dient
als Leitfaden für Politik, Gesellschaft und Individuen (vgl. ebd.). Die Überzeugung, dass das
Konzept „des Marktes“ in zahlreichen Lebensbereichen und Wissenschaftler*innen
handlungsleitend ist, beschreibt Walter Ötsch als Marktfundamentalismus (vgl. ebd., p. 11).
Auslöser der Ökonomisierung Sozialer Arbeit
Nach den Definitionen des Berufsfeldes der Sozialen Arbeit und dem Begriff der
Ökonomisierung sowie der knappen Beschreibung zum kulturhistorischen Kontext des
Konzepts „des Markts“ wird in diesem Kapitel zunächst kurz die Entwicklung der Sozialpolitik
weg von einem Wohlfahrtsstaat hin zu einem Aktivierungsstaat skizziert. Im Anschluss daran
werden beispielhaft Auswirkungen der Ökonomisierung und ihre Folgen innerhalb der
Sozialen Arbeit erläutert. Meines Erachtens liegt der wichtigste Aspekt hierfür in den
einschneidenden Veränderungen der Sozialpolitik ab 1998. Sie bahnten sich bereits in der
Ära Kohl an und wurden in der Ära Gerhard Schröder mit der Einführung der Agenda 2010
fortgeführt (vgl. Schmidt, 2005, p. 99; vgl. Hagn, 2017, p. 75). Sie gaben den Anstoß für das
New Publish Management, die Einführung des Wettbewerbs und der Marktlogiken im
Sozialwesen.
Die Entwicklungen der Sozialpolitik ab 1998 weg vom Wohlfahrtsstaat hin zur
Aktivierungspolitik
„Sozialpolitik zielt vor allem auf Schutz vor Not, auf Sicherungen gegen Wechselfälle des
Lebens und - im fortgeschrittenen Stadium darauf - soziale Ungleichheit
einzudämmen“ (Schmidt, 2005, p. 11). Margaret Thatcher und Ronald Reagan trieben ab den
1970er Jahren die Deregulierung des Finanzsektors und des Arbeitsmarktes sowie die
Privatisierung zahlreicher Staatsunternehmen voran. Wirtschaftslobbyisten und Neoliberale
unterstützten dies und verlangten entsprechende Reformen. Dies führte dazu, dass sich
Wohlfahrtsstaaten durch vermehrte Reformmaßnahmen in Richtung Wettbewerbsstaat
entwickelten. Folgende zwei Punkte waren dabei richtungsweisend. Zum einen galt es in der
Wirkung nach außen, „die Konkurrenzfähigkeit des eigenen Wirtschaftsstandorts auf dem
Weltmarkt zu behaupten“ (Hagn, 2017, p. 78). Zum anderen sollten „die Marktmechanismen
und (betriebs-)wirtschaftlichen Gestaltungsprinzipien auf die eigenen administrativen
Organisationsstrukturen übertragen [werden], einschließlich der Sozialadministration“ (ebd.).
„Die Sozialpolitik soll nicht mehr für den gesellschaftlichen Ausgleich, sondern für mehr
Wettbewerb und Beschäftigung sorgen“ (ebd.).
Fehmel (vgl. 2019, p. 81) beschreibt, dass in den letzten drei Jahrzehnten ein beschleunigter
Rückbau des deutschen Sozialstaates stattgefunden hat. 1998 gab es auf Bundesebene
einen Regierungswechsel, der Änderungen in der Sozialpolitik mit sich zog (vgl. Tabatt-
Hirschfeldt, 2016, p. 48). Die Bundesregierung SPD-B90/Grüne-Koalition (rot-grün) unter
Bundeskanzler Gerhard Schröder propagierte spätestens mit der Agenda 2010 das Modell
des aktivierenden Staats (vgl. Galuske, 2008, p. 13). Galuske bringt die Kernaspekte des
aktivierenden Staats auf den Punkt: „mehr Markt und mehr Selbstverantwortung“ (ebd.
2008). Hinter dem Aspekt „mehr Markt“ steckt die Haltung, dass „der aktivierende
Sozialstaat prinzipiell auf weniger staatliche Regulierung und mehr auf Markt und Konkurrenz
[setzt]“ (ebd.). Des Weiteren geht es um die Reduzierung staatlicher Eingriffe in das
Marktgeschehen (vgl. ebd., p. 14).
Unter dem Aspekt der Selbstverantwortung verbirgt sich der Punkt, dass Bürger*innen mehr
Eigenverantwortung übernehmen und der Staat sich aus der Finanzierung zahlreicher
bisheriger Sozialleistungen zurückzieht (ebd.). So brachte die Agenda 2010 eine Senkung des
Rentenniveaus, Absenkung des Krankengeldes, Einführung der Praxisgebühr sowie die
Zusammenlegung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe mit sich. Letzteres ist unter dem Begriff
„Hartz IV“-Reform bekannt (vgl. Tabatt-Hirschfeldt, 2016, p. 48). Die Forderung nach der
Steigerung der Selbstverantwortung kann unter dem Schlagwort der Agenda 2010 „Fördern
und Fordern“ zusammengefasst werden. Es wird nicht mehr als Aufgabe des Staats
angesehen, Menschen in der Arbeitslosigkeit zu unterstützen und sich weiterzubilden, um
bessere Chancen auf dem Arbeitsmarkt zu haben. Die Perspektive hat sich dahin gehend
geändert, dass nicht mehr das „Nichtstun“ während der Arbeitslosigkeit finanziert werden
soll. Stattdessen sollen erwerbslose und erwerbstätige Menschen besser für die
Anforderungen des Arbeitsmarkts vorbereitet werden. (vgl. Dahme and Wohlfahrt, 2005, p.
10) Dahinter steckts erstens das Ziel, sich auf die Erfordernisse des Arbeitsmarktes
anzupassen und zweitens die Message „für die Pflege seines „Kapitals“ in Form seiner Kraft,
Motivation, Flexibilität und Qualifikation [selbst verantwortlich zu sein]“ (Galuske, 2008, p.
15).
Diese Haltung des „Fordern und Förderns“ ist nicht nur in der Arbeitsmarktpolitik, sondern
auch in anderen Politikbereichen, wie zum Beispiel in der Gesundheits,-Bildungs,-Alten- und
Familienpolitik, handlungsleitend. Mit der sich verändernden Perspektive der Rolle des Staats
spiegelt sie daher einen Paradigmenwechsel wider (vgl. Fehmel, 2019, p. 85). Fehmel
formuliert, dass die Funktionssysteme Sozialpolitik und Soziale Arbeit „aufeinander
angewiesen sind und kaum voneinander lösbar sind“ (ebd., p. 199).
Die Auswirkungen des gerade beschriebenen Paradigmenwechsel auf das Berufsfeld der
Sozialen Arbeit werden in den Abschnitten 3.2, 3.3 und 3.4 dieses Kapitels beschrieben.
Das Konzept des Neuen Steuerungsmodells (NSM)
Wie bereits in 3.1 beschrieben, erfolgte seit Beginn der 1990er Jahre eine Veränderung der
Sozialpolitik, die einerseits auf eine Modernisierung des Staats, andererseits auf eine
Modernisierung der Verwaltung abzielte (vgl. Buestrich et al., 2008, p. 42). Auf kommunaler
Ebene wurde der Prozess unter dem Namen „Neues Steuerungsmodell“ (NSM) vollzogen.
Mit ihm sollten Steuerungslücken und Effizienzprobleme abgeschafft und „mit
betriebswirtschaftlichen Organisationsformen und Instrumenten die Binnenstrukturen und
das Verwaltungshandeln effizienter und effektiver, bürgerfreundlicher und rationaler […]
[gestaltet werden]“ (Hagn, 2017, p. 81). Das NSM lehnte sich an das angelsächsische Konzept
des New Publish Management (NPM) an, dass von dem Ideal des Neoliberalismus geprägt ist.
Pelizzari (2001, p. 67)schreibt, dass dem New Public Management
„die Definitionsmacht über staatliche Aufgabenerfüllung von den Entscheidungsstrukturen
parlamentarischer Instanzen hin auf die betriebswirtschaftliche Finanzkontrolle übertragen [wird], womit die finanzpolitischen Entscheide zunehmend an eine scheinbar unpolitische Legitimationsquelle gebunden werden. Diese allgemeine Entpolitisierung des Verwaltungshandelns erfolgt also durch den Übergang von
einer primär rechtlichen Steuerung des Verwaltungshandelns zu einer Steuerung durch ökomische
Kennziffern.“
In allen Kommunen erfolgte die verbindliche Einführung des NSM. Im Hinblick auf leere
Kassen der Kommunen wurde es als zweckmäßiges Mittel für einen „Rationalisierungs- und
Qualitätsverbesserungsprozess in der Sozialen Arbeit“ (Seithe, 2012, p. 121) gesehen. Die
Verwaltungsmodernisierung stand unter dem Leitstern der Effizienz. Politik und Verwaltung
sollen dem Dienstleistungsgedanken dienen. Konzepte der Privatwirtschaft und der
Unternehmensführung wurden in der Verwaltung eingeführt (vgl. Dahme et al., 2008, p. 38
f.).
Nach Schedler und Proeller (2000) zählen diese weiteren Merkmale zum NSM:
• die Dezentralisierung der Führungs- und Organisationsstrukturen, die über Kontrakte
und Zielvereinbarungen gesteuert werden
• statt der bisherigen Inputsteuerung (Zuteilung von Personal, Finanz- und Sachmitteln,
die durch den Haushalt zugewiesen werden) erfolgt eine Out-Put Orientierung
(Steuerung anhand strategischer Ziele, einem Berichtwesen mit Leistungsindikatoren
und vorgegeben Budgets auf Grundlage von Kontrakten)
• Aktivierung der Verwaltungsmitarbeiter*innen durch die Einführung eines
organisationsinternen Wettbewerbs aufgrund von Zielvereinbarungen,
Kundenorientierung und Qualitätsmanagement
Die Folgen des NSM hatten einen starken Einfluss in den Alltag der Einrichtungen im
Sozialwesen hinein. Einrichtungen erhielten den Auftrag zur Erstellung von Leitbildern,
Produktdefinitionen und Qualitätsmerkmalen sowie zur Erstellung von Kennziffern. Sie
müssen sich um Zertifizierungen qualifizieren und in Rankings behaupten. Des Weiteren sind
sie einem verstärkten Berichtswesen verpflichtet und von neuen Finanzierungsmodellen und
Vergaberichtlinien abhängig (vgl. Galuske, 2008, p. 18 f.). Steuerten bisher durch Bürokratie
gezeichnete Prozesse die Soziale Arbeit, übernahmen nun betriebswirtschaftliche
Steuerungselemente die Führung (vgl. Seithe, 2012, p. 121). Wettbewerb und die Einführung
marktähnlicher Strukturen sollten die Leistungen der Verwaltungen, den sogenannten
Output, steigern. Ein Merkmal dieses Prozesses ist, dass Verwaltungsstrukturen und das
Ausführen von verwaltungsorganisatorischen Abläufen unternehmerischen Entscheidungen
gleichgesetzt werden und die Produkte von Verwaltungen auf „Quasi-Märkten“ bestmöglich
platziert werden sollen (vgl. Buestrich et al., 2008, p. 43). Dieser Aspekt der Quasi-Märkte ist
ein weiterer wichtiger Aspekt der Ökonomisierung der Sozialen Arbeit und wir daher unter in einem eigenen Punkt weiter ausgeführt.
Das Eindringen des Konzepts „des Marktes“ in die Soziale Arbeit
Das Modell des Wohlfahrtsstaats agierte nach den Prinzipien, dass der Staat Sozialleistungen
sicherstellte, dass freie Träger bei der Überlassung von sozialen Aufgaben den Vorzug
erhielten sowie nach dem Selbstkostendeckungsprinzip. Diese Art der Steuerung und
Finanzierung wurde als einerseits nicht mehr zeitgemäß, andererseits als zu teuer gehalten.
Das Einführen des NSM und des Marktfundamentalismus im Sozialwesen zielten daher
kontinuierlich auf das Einsparen von Kosten ab (vgl. Seithe, 2012, p. 125). „[…] Die
„Verschiebung der Sozialen Arbeit vom öffentlichen in den ökonomischen Sektor“ galt als
Paradigmenwechsel (ebd., p. 124). Was zunächst nur den für den öffentlichen Teilbereich des
Sozialwesens angedacht war, hat sich längst als elementares Prinzip innerhalb der Sozialen
Arbeit implementiert (vgl. ebd.).
Bisher in die 1990er Jahre galt das Selbstdeckungskostenprinzip in der Sozialen Arbeit. Dies
bedeutet, dass der Staat die Kosten für soziale Dienstleistungen vollständig übernommen hat.
Stattdessen erfolgten nun Leistungs- und Vergütungsvereinbarungen, anhand derer
erbrachte soziale Dienstleistungen anhand eines definierten Entgelts abgerechnet werden
(vgl. Tabatt-Hirschfeldt, 2016, p. 49). Damit drückten sich Veränderungen in der Beziehung
zwischen freien und öffentlichen Trägern aus. Galuske (2007) beschreibt diesen
Paradigmenwechsel mit den Worten „vom Recht zum Markt“ sowie von der „Sach- zur
Geldleistung“. Mit der Einführung des NSM erfolgte nach und nach eine konsequente
Umgestaltung des kompletten Sozialwesens hin zum Marktfundamentalismus. Dies bedeutet,
dass auch in der Sozialen Arbeit Marktstrukturen eingeführt wurden. Ziel war dabei zum
einen die effizientere und effektivere Versorgung der Menschen, die auf Unterstützung
angewiesen sind (vgl. Spatscheck and Arnegger, M., 2008, p. 16). Zum anderen sollte sich „[…]
staatliches Wirken weitestgehend auf die Steuerung des Marktes mit
wettbewerbsorientierten Mitteln [.] reduzieren“ (ebd.).
Da bei diesem Konstrukt die gesamte Finanzierung des Marktes in staatlicher Hand bleibt
und der Markt nicht so funktioniert wie produzierten Waren, spricht man von „Quasi-
Märkten“ (vgl. Hensen, G., 2006, p. 161; vgl. Seithe, 2012, p. 140). Flösser und Vollhase
spitzen es zu, wenn sie formulieren, wenn sie von einem „politisch inszenierten“ Sozialmarkt
sprechen (vgl. 2006, p. 84). Die Änderung in der Gesetzesgrundlage und die damit
verbundenen Konsequenzen für die Rahmenbedingungen des professionellen pädagogischen
Handelns und staatlicher Leistungsgewährung sind folgenschwer. Leistungserbringer
operieren jetzt auf einem künstlichen geschaffenen Markt, auf dem der Staat das
Nachfragemonopol hält (vgl. Spatscheck and Arnegger, M., 2008, p. 16).
Soziale Dienstleistungen finden ab sofort in einem „kapitalistischen Akkumulationsprozess“ [statt], indem versucht wird, mit Hilfe eines Kapitaleinsatzes einen Überschuss zu erzielen“ (Wohlfahrt, 2017, p. 61). Das Marktgeschehen greift hier genauso wie bei einem faktischen Markt. Aus Menschen mit Unterstützungsbedarf werden Kund*innen, die soziale Dienstleistungen nachfragen und dafür bezahlen.
Der Markt der sozialen Dienstleistungen konkurriert um zahlungsfähige Kund*innen. Zu beachten ist allerdings, dass es sich zum Beispiel beim Persönlichen Budget um staatliche
Transferleistungen handelt (vgl. ebd.). Ein*e Kund*in im Blumenladen kann eigenmächtig
entscheiden, welche Blumen er*sie mit seinem Geld kauft. Auf dem „Quasi-Markt“ der
sozialen Dienstleistungen greift die ursprüngliche Position eine*r Kund*in nicht. Die Aspekte
der eingegrenzten Alternativen und die bei einigen Bereichen fehlende Möglichkeit,
Angebote auszuschlagen, verdeutlichen ebenfalls, „dass hier nicht der Markt [die
„Kundenbeziehung“ beherrscht], sondern staatliche ordnungspolitische Zwecksetzungen (vgl.
Seithe, 2012, pp. 140, 225). Ein weiterer wichtiger Aspekt ist, dass Klient*innen sozialer
Dienstleistungen finanziell nicht im Stande sind, die Kosten dafür zu übernehmen (vgl.
Flösser and Vollhase, 2006, p. 82). Seithe beschreibt die als Nutzer*innen ohne
Kund*innenstatus. Des Weiteren ist anzuführen, dass sich Klient*innen nicht wie
selbstständige, aktiv nachfragende und unabhängige Kund*innen verhalten bzw. verhalten
können. Daher ist es schwierig, Menschen, die soziale Arbeit in Anspruch nehmen (müssen)
einen Kund*innenenstatus zuzuschreiben (vgl. Seithe, 2012, p. 140;225). Die beschriebenen
Punkte bilden die Veränderungen der Ökonomisierung auf der Mikroebene ab.
Hier liegt die Annahme zugrunde, dass das Handeln von öffentlichen Verwaltungen mit
Entscheidungen von Unternehmen, die ihre Waren auf dem Markt bestmöglich platzieren
wollen, gleichwertig anzusehen ist (vgl. Buestrich et al., 2008, p. 48). Kontinuierliche und
systematische Leistungs- und Kostenvergleiche und (Benchmarking, Outcomesteuerung) im
Sozialwesen sollen eine Markttransparenz schaffen. Diese soll wiederum die staatlich
finanzierten Angebote für Klient*innen bzw. das für zahlungsfähige Kund*innen steuern (vgl.
Wohlfahrt, 2017, p. 61). Auch die Aspekte der Qualitätssicherung der Angebote sind
Ergebnisse der Vermarktlichung. Die Erstellung von Leitbildern und Qualitätsvereinbarungen
mit Qualitätsentwicklung und Qualitätsüberprüfung spiegeln dies wider (vgl. Buestrich et al.,
2008, p. 41).
Auch auf der Mesoebene hinterlässt das Konzept „des Markts“ Spuren. Freie Träger werden
zu Leistungserbringern. Es herrscht hohe Konkurrenz zwischen den Leistungserbringern um
die zeitlich befristeten ausgeschriebenen Leistungen (Leistungen der Eingliederungshilfe,
Ausschreibungen für Projekte o.Ä.). In profitablen Bereichen der Sozialen Arbeit, wie zum
Beispiel bei privaten Bildungseinrichtungen oder Altenhilfe, entstehen zahlreiche
gewerbliche Träger. Dies hat einen zusätzlichen zunehmenden Wettbewerb zur Folge (vgl.
Tabatt-Hirschfeldt, 2016, p. 49; vgl. Spatscheck and Arnegger, M., 2008, p. 20).
Im Prozess des Eindringens der Marktstrukturen erfolgt auch die Teilprivatisierung in
Bereichen der Sozialpolitik. Hierfür spielen bereits genannte Gründe eine wichtige Rolle. Die
Kosten für das Sozialsystem sollen finanzierbar bleiben und die Effizienz der sozialen
Dienstleistungen erhöht werden. In diesem Sinne werden die staatlichen Sozialleistungen
reduziert. Die private Vorsorge jedes einzelnen rückt damit deutlich in den Vordergrund und
wird damit eine grundlegende Säule im eigenen Sicherungssystem (vgl. Haupt, 2017, p. 124).
Der Staat gibt sozialpolitische Verantwortung ab und übernimmt die Rolle der Steuerung des
Marktes. Er verfolgt dabei das Ziel, als Kostenträger auf eine effiziente Verteilung der Mittel
mit gleichzeitiger Kostensenkung zu achten (vgl. Seithe, 2012, p. 126).
Auswirkungen der Ökonomisierung in der Sozialen Arbeit
Unternehmen, die innerhalb des Sozialwesens agieren, sind einem
„Strategiedilemma“ ausgesetzt. Ursprünglich aus der Bedarfswirtschaft entstanden, geht es
inzwischen um die Erfüllung der Ansprüche im Rahmen einer Funktionswirtschaft. Dies
bedeutet, dass sie nicht mehr nur Unterstützungsangebote für Menschen bereitstellen,
sondern daraus auch zusätzlich einen Mehrwert erwirtschaften muss. Nach Lambers müssen
in diesem Dilemma sowohl strategisch-ökonomische als auch normativ-kritische
Anspruchsgruppen gleichwertig bedacht werden (vgl. Lambers, 2016, p. 68).
Die grundlegende Änderung des Finanzierungsprinzips sozialer Dienstleistungen spiegelt den
gerade genannten Aspekt sehr klar wider. Der Wegfall des Selbstkostenprinzips als
Finanzierungsrundlage für Dienstleistungen gemeinnütziger Träger „[…] beraubte sie vor
allem auf kommunaler Ebene auch ihrer advokatischen politischen Funktion“ (Hagn, 2017, p.
76). Das zuvor partnerschaftliche Verhältnis auf Augenhöhe zwischen freien und öffentlichen
Trägern im Sozialwesen wandelte sich in ein zielgerichtetes und hierarchisches
Dienstleistungsverhältnis mit einer Beziehung zwischen Auftraggeber und Auftragnehmern
(vgl. ebd., p. 87). Mit Hinblick auf Kostenreduzierung und dem Auftrag, stets effizient zu
agieren, fällt die Umsetzung des sozialethischen, advokatorischen und zivilgesellschaftlichen
Auftrags schwer (vgl. Dahme et al., 2008).
Die Privatisierung im Sozialwesen führt weiterhin zu einer Verlagerung der
Verantwortlichkeiten für die Existenz der Einrichtung hin bis zur Mitarbeiter-Ebene. Träger
von Einrichtungen und Organisationen sind nun gezwungen, nach den Regeln „des
Marktes“ im Sinne des Betriebs bzw. der Einrichtung zu handeln und zu wirtschaften.
Gleichzeitig wird die Abhängigkeit der einzelnen Sozialarbeiter*innen zu ihrer Einrichtung
durch die geänderten Strukturen merklich größer. Möglicherweise gibt es Fälle, in denen die
Loyalität gegenüber der Einrichtung fachlichen Interessen des pädagogisch professionellen
Handels weichen muss (vgl. Seithe, 2012, p. 126 f.).
Bis 2005 der Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVÖD) eingeführt wurde, war der
Bundes-Angestelltentarifvertrag (BAT) im Sozialwesen der übliche Tarifvertrag. Die im Zuge
der Ökonomisierung der Sozialen Arbeit veränderten Refinanzierungen der Leistungen durch
z.B. Leistungs- und Vergütungsvereinbarungen, führten zudem zu einer Abkehr von
Tarifstrukturen. Zum Erhalt der Wettbewerbsfähigkeit forderten Unternehmen im
Sozialwesen weitere Deregulierungen und eine weitere Abkehr der Tarifpolitik des
öffentlichen Dienstes (vgl. Giesecke, 2012, p. 30; vgl. Buestrich et al., 2008, p. 116 ff.). Im
gleichen Zeitfenster nahm die Teilzeitbeschäftigung im Sozialwesen um 13 % zu. In anderen
Berufsfeldern lag die Zahl bei 7%. Etwa 50% der Sozialarbeiter*innen und Erzieher*innen
waren zwischen 1998 und 2008 in den ersten fünf Berufsjahren von Befristungen betroffen
(vgl. Fuchs-Rechlin, 2012, p. 33). Ein weiterer Gesichtspunkt ist, dass aufgrund der Steuerung
und Kostendrucks innerhalb der Sozialen Arbeit für manche Einrichtungen es wirtschaftlich
attraktiver erscheint, sich auf die leichteren und erfolgsversprechenden Fälle zu fokussieren.
„Werden die - politisch gewollt verknappten - Mittel nach Erfolgsaussichten differenziert
eingesetzt, dann wird auch Soziale Arbeit `investiv` und das heißt auch `selektierend` und
exkludierend ausgerichtet“ (Hagn, 2017, p. 89). Wird nach diesem Prinzip agiert, bleiben
diejenigen mit dem größten Bedarf größten an Hilfe – und Unterstützungsbedarf auf der
Strecke (vgl. ebd.).
Studien belegen, dass neben Gerechtigkeits- und Wirtschaftsgedanken inzwischen auch der
Dienstleistungsgedanke in der Professionalität in der Sozialen Arbeit eingezogen ist.
Qualitätsmanagement wird als Mittel zur Steigerung der Fachlichkeit angesehen (vgl. Dahme
and Wohlfahrt, 2005, p. 205 ff). Die Einführung von Wettbewerb- und Marktstrukturen in der
Sozialen Arbeit wird nach Staub-Bernasconi (vgl. Staub-Bernasconi, 2010, p. 89) nicht als
generell gewollt, aber letztlich als nicht veränderbare strukturelle Normativität angesehen.
Fazit
In dieser Hausarbeit wurden beispielhaft Aspekte der Ökonomisierung seit Ende der 1990er
Jahre in der Sozialen Arbeit untersucht. Das Ergebnis zeigt, dass die weitreichenden Folgen
der Ökonomisierung deutlich im Sozialwesen spürbar sind und alle Bereiche - Kindergärten
und Kindertagesstätten, Offene Kinder- und Jugendarbeit, die Behindertenhilfe sowie
zahlreiche weitere marginalisierte Gruppen, betroffen sind.
Die derzeitigen desaströsen Arbeitsbedingungen innerhalb der Sozialen Arbeit sind die
Konsequenzen der Sozialpolitik der vergangenen 30 Jahren. Sie wirken strukturell in Makro-,
Meso- und Mikroebene des Sozialwesens. Die Abhängigkeit und drastischen
Wechselwirkungen zwischen Sozialer Arbeit und Gesellschaft- und Sozialpolitik sind für
Angestellte im Sozialwesen sehr belastend. Es wird klar ersichtlich, dass soziale
Dienstleistungen unter Marktbedingungen zu Qualitätsverlusten auf gesamtgesellschaftlicher
Ebene führen und Sozialarbeiter*innen in nicht endenden Dilemmata allein lassen.
Sozialarbeiter*innen stehen unter dem Druck, strategisch-ökonomische Ziele der
Organisationen um zu setzen anstatt normativ-kritisch nach ihrem pädagogisch
professionellen Anspruch zu handeln. Durch den Wegfall des Selbstkostenprinzips einer
Bedarfswirtschaft hin zu einer Funktionswirtschaft ist die advokatische Funktion gegenüber
Klient*innen massiv ins Hintertreffen geraten.
Originär obliegt der Politik die Verantwortung für eine Sozialpolitik, die Gestaltungsräume im
pädagogisch professionellen Handeln ermöglicht. Eine Trendwende der aktuellen
Sozialpolitik ist derzeit nicht zu erwarten. Da Soziale Arbeit in ihrer Profession
gesellschaftsgestaltende und systemkritische Elemente besitzt, gilt es, diese wieder
freizusetzen. Eine Möglichkeit besteht darin, einen höheren Organisationsgrad innerhalb des
Sozialwesens anzustreben. Eine Vernetzung unter verschiedenen Berufsgruppen, wie zum
Beispiel auch mit medizinisch-pflegerischem Personal, halte ich für einen ersten guten Schritt,
eine sozial-ökologische Transformation anzustoßen. Letztlich zeigt die Arbeit auf, dass
meinem subjektiven Empfinden von massiven Mängeln im Sozialwesen politische
Entscheidungen zugrunde liegen.
©WhoCares. Alle Rechte vorbehalten.
Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden der Übersetzungen
Wir nutzen einen Drittanbieter-Service, um den Inhalt der Website zu übersetzen, der möglicherweise Daten über Ihre Aktivitäten sammelt. Bitte überprüfen Sie die Details in der Datenschutzerklärung und akzeptieren Sie den Dienst, um die Übersetzungen zu sehen.